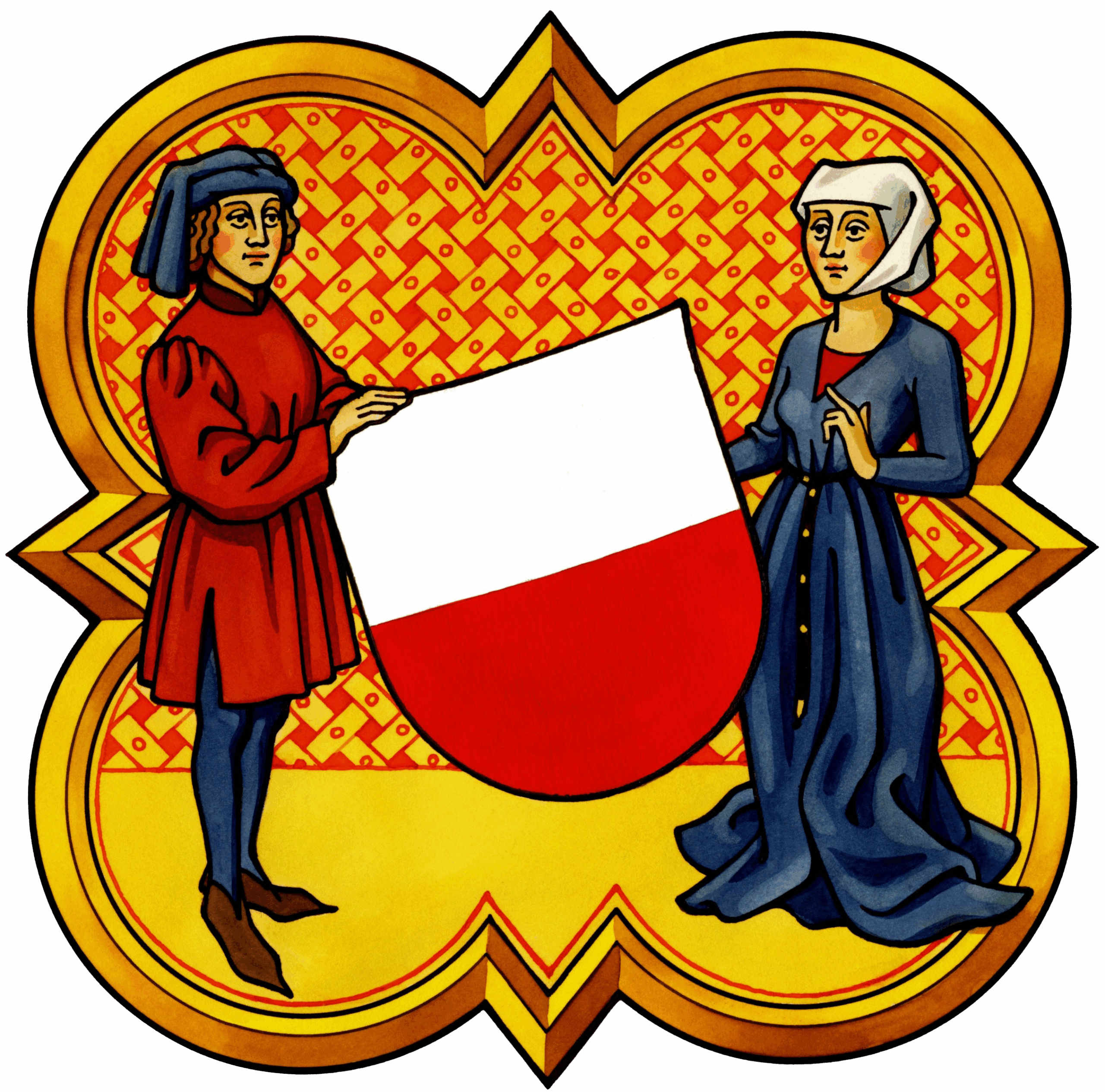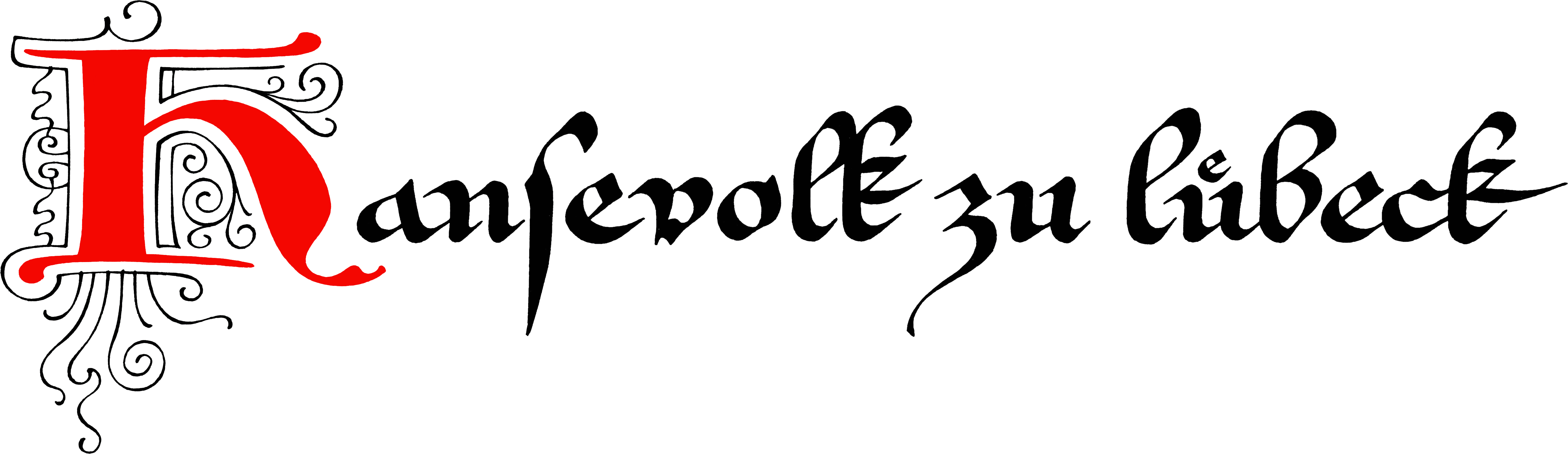Unser 10-jähriges Vereinsjubiläum nahmen wir zum Anlass, unsere inzwischen sehr umfangreiche spätmittelalterliche Ausstattung der Öffentlichkeit im Rahmen einer Ausstellung zu präsentieren. Vom 24. Oktober bis zum 7. November 2010 zeigten wir in der Lübecker Königspassage Kleidung und Gebrauchsgegenstände aus dem Lübecker Leben des 15. Jahrhunderts. Die Gewänder haben die Mitglieder des Hansevolks nach historischen Vorbildern selbst genäht. Auch alle anderen Exponate entstammen, soweit möglich, dem handwerklichen Geschick ihrer Besitzer, alles auf der Grundlage sorgfältiger Recherchen in Büchern, seriösen Internetquellen und Museen.

Wir feiern Jubiläum
Kommt einfach vorbei und feiert mit uns
am 13.09.2025
auf dem Lübecker Kohlmarkt
Aus dem Publikum kam der Wunsch, die Fotos der Exponate und erklärende Texte zu den einzelnen Themen im Internet vollständig wiederzugeben.
Diesem Wunsch kommen wir gerne nach.
Fernhandelskaufleute >
Fernhandelskaufleute bildeten die reiche und einflussreiche Oberschicht der Hansestadt. Fast alle Mitglieder des Rates waren vermögende Kaufleute.
Die Szene zeigt einen Fernhandelskaufmann und seine Frau in seinem Kontor.
Vor dem Kaufmann liegen einige wichtige Arbeitsmittel: Rechentuch mit Rechenmünzen, Balkenwaage, Goldwaage, Schreibtafel aus mit Ruß geschwärztem Wachs, ein Buch und ein Sack mit Münzen verschiedener Länder und Städte.
Die Kaufleute sind umgeben von einigen typischen Handelswaren der Hansezeit: ein Fass Salz aus Lüneburg, ein Fass Rheinwein aus Köln, ein Ballen bestes flandrisches Tuch aus Brügge, Bernstein aus Danzig, Langer Pfeffer aus Lissabon,der den weiten Weg von den Molukken nach Europa gefunden hat, Wachs und kostbare Felle aus Nowgorod: Fuchs, Otter, Marder und sogar der kostbare Hermelin, dessen Verwendung dem Hochadel vorbehalten war.
Im Hansevolk zeigen die Kaufleute (Severin Warendorp, Engelke van Soost und andere) dem Publikum, wie man mit dem Rechentuch rechnet und erklären die Vielfalt der mittelalterlichen Maße und Gewichte.
Bei besonderen Anlässen führt der Verein den „Zug der Hansekaufleute“ auf: Waren werden von einer Kraweel entladen, mit Wagen, Trägern und Lastpferden durch die Stadt getragen, auf dem Markt von der städtischen Obrigkeit geprüft und freigegeben (In Kooperation mit befreundeten Vereinen wie der Gesellschaft Weltkulturgut und dem Bauspielplatz Roter Hahn).
Die Kleidung des Mannes
Der Kaufherr trägt einen Rock aus bestem flandrischen Tuch, mit Pelz verbrämt.
Darunter – über dem weißen Leinenhemd – trägt er eine eng geschnittene kurze Jacke aus Wollstoff, das Wams, dessen Ärmel in diesem Fall aus Seidenbrokat bestehen.
Die hauteng geschnittenen Hosen werden nicht durch Gürtel oder Hosenträger gehalten, sondern mit so genannten „Nestelbändern“ am Wams befestigt.
Am Gürtel, der über dem Rock getragen wird, hängen Tasche und Dolch. Die Schuhe sind wendegenäht, mit flacher Sohle.
Als Mann von Welt trägt der Kaufmann als Kopfbedeckung ein elegantes Chaperon.
Die Mitglieder des Hansevolks nähen ihre Gewandung selbst oder lassen sie nach eigenen Vorgaben nähen. Material und Schnitt werden nach historischen Vorbildern ausgewählt. Auch die Gewänder des Kaufmanns, Severin Warendorp, wurden – bis auf Schuhe, Gürtel, Tasche und Dolch – von ihrem Besitzer selbst gefertigt.
Häusliche Nähstube >
Im Mittelalter – und auch noch lange danach – wurden viele Kleidungsstücke und Gegenstände des täglichen Bedarfs im eigenen Haushalt hergestellt. Kleidung wurde viel länger getragen und musste folglich regelmäßig ausgebessert werden.
Somit gehörten Spinnen, Nähen und verschiedene Handarbeitstechniken zu den selbstverständlichen Fertigkeiten einer Hausfrau. Bei den ärmeren Leuten war dies eine bittere Notwendigkeit. Aber auch von reichen Frauen, wie wir sie hier sehen, wurde erwartet, dass ihre Hände nicht untätig ruhten.
Wir sehen:
- Handspindel mit gesponnenem Faden, Spinnwirtel und unversponnene Wolle
- begonnener Strumpf im Nadelbinden-Verfahren, Nadel aus Bein (Knochen). Diese Technik war ein Vorläufer des Strickens.
- Nestelbänder unterschiedlicher Machart und aus verschiedenen Materialien, zum Verschließen von Kleidungsstücken, zur
Befestigung von Knöpfen oder einfach zur Zierde - Schere
- Handgesäumtes Haubentuch aus weißem Haubenleinen und fertig gesteckte Hauben, davon eine mit genähten Biesen, wie sie im süddeutschen Raum viel getragen wurden.
- Ärmel aus unterschiedlichen Materialien, die – je nach Anlass – mit Nadeln an das Gewand angesteckt wurden
- Taschen: Frauen trugen sie unter dem Obergewand am Ledergürtel
- Nestelspitzen zum Einfädeln der Bänder in die Nestllöcher
- Knöpfe aus Zinn und aus Silber
- Stoffknöpfe
- genähte Strümpfe: gestrickte Strümpfe sind erst aus späteren Jahrhunderten belegt.
In der Hoffstede des Hansevolks sind immer Frauen zu sehen, die Kleidung ausbessern, an einem Saum sticheln, an einer Stickerei arbeiten oder Bänder nesteln.
Das Publikum, besonders das weibliche, lässt sich gerne zeigen, wie man mit der Technik des Fingerwebens aus farbigen Wollresten Armbändchen nestelt.
Küche >
Essen und Trinken
Die Alltagsnahrung der Menschen im Spätmittelalter bestand zu einem sehr viel höheren Anteil aus Getreide in Form von Brei oder Brot.
Fleisch galt als das wertvollste, Gemüse war eher nebensächlich – kein Wunder, denn es wurde meist viel zu lange gekocht. Rohes Gemüse, z.B. Salat, galt allenfalls als Notessen. Auch war die Auswahl an Gemüse und Obst deutlich schmaler als heute. Tomaten, Paprika, Kartoffeln und viele anderen Gewächse kamen erst mit der Entdeckung Amerikas zu uns.
Wer es sich leisten konnte, sparte nicht an Gewürzen. Pfeffer, Zimt, Nelken, Koriander, Kardamom, Safran, Muskat, Ingwer bzw. Galgant wurden gern großzügig angewendet, manchmal in für uns ungewohnten Zusammenstellungen.
Das Volksgetränk – auch für Kinder – war dünnes Bier. Wer es sich leisten konnte, trank Wein – am liebsten Rheinwein. Heiße Getränke fehlten vollständig. Man kannte Kräutertees, aber diese wurden eher als Medizin eingesetzt, nicht zum Genuss.
Die Köchinnen des Hansevolks, Elseke Iserenhant und Walpurgis Knust, beköstigen im Lager aus ihrer Feldküche an die 20 Personen, mit Gästen auch einmal mehr.
Küche
Mittelalterliche Küchenutensilien:
Grape (Kochtopf aus Ton), Lübecker Kanne, diverse Kellen, Schöpflöffel, Kochlöffel.
Essgeschirr sowie Löffel waren gewöhnlich aus Holz, Zinnteller kamen nur bei besseren Herrschaften auf den Tisch. Getrunken wurde ebenfalls aus hölzernen Bechern oder aus Zinnbechern, am häufigsten aber aus Tonkrügen (Kruse). Die grünlichen, meistens genopptem Gläser aus Venedig konnten sich nur die ganz Reichen leisten.
Gezeigt wird ein Gedeck, bestehend aus Holzteller, Krug aus Siegburger Keramik, Zinnlöffel, Messer und Pfriem (einzinkige Gabel) aus Eisen – Gabeln, wie wir sie kennen, gab es noch nicht, allenfalls kleine zweizinkige. Oft aßen mehrere Personen aus einer Schüssel. Auf Reisen war es ratsam, Becher, Messer, Löffel und ggf. ein Mundtuch selber mitzuführen.
Korb mit Äpfeln und Zwiebeln.
Jedes Vereinsmitglied bringt in die Hoffstede (Lager bei Veranstaltungen) sein eigenes Gedeck mit, je nach Stand aus einfachem oder teurem Material.
Pilger / Pilgerin >
Über die Straßen Europas bewegte sich ein stetiger, mitunter beängstigend starker Strom von Pilgern zu fernen Zielen wie Rom, Santiago de Compostella oder gar Jerusalem.
Aber auch zahlreiche Städte in wesentlich geringerer Entfernung wurden angestrebt, so sie denn einige viel versprechende Reliquien oder andere Heiligtümer vorzuweisen hatten.
Die Pilgerfahrt konnte als Erfüllung eines Gelübdes oder zum Abbüßen einer Schuld unternommen werden. Sie konnte die strafende Auflage einer geistlichen oder weltlichen Obrigkeit sein. Manchmal war es auch einfach eine Vergnügungsreise.
Die beiden Figuren tragen die typische Pilgerausstattung: Hut bzw. Haube, Wanderstab, Flasche, Ersatzschuhe, Bündel sowie ein kleine Horntröte. Am Hut sehen wir das Abzeichen von Roquamadour, einem kleinen Wallfahrtsort in Mittelfrankreich.
Das Hansevolk begibt sich einmal im Jahr auf eine zweitägige „Gewanderung“ in mittelalterlicher Gewandung, oft entlang den alten Pilgerrouten. Übernachtet wird zünftig in einer Heuherberge oder in einer historischen Unterkunft (z.B. in der Turmhügelburg bei Lütjenburg).
Ratsapotheke >
1412 wurde die Lübecker Ratsapotheke als wohl erste städtische Apotheke im Deutschen Reich gegründet. Sie bestand bis 1846.
Das Wort Apotheke stammt aus dem Griechischen und bedeutet Aufbewahrungsort. So ist es nicht verwunderlich, dass dort nicht nur Kräuteressenzen, wässrigen Auszügen, Pasten, Pillen usw. hergestellt wurden, sondern auch Waren aus fernen Ländern in der Apotheke gelagert und von dort verkauft wurden.
Besonders gut verdiente der Rat am Gewürzhandel, denn im Mittelalter wurden Gewürze teilweise mit Gold aufgewogen.
Gewürze verwendete der Apotheker zur Herstellung von Würzweinen (Hypocras, Claret) und von Konfekt. Beides konnten sich nur die reichen Kaufleute, die „Pfeffersäcke“, leisten.
Zu sehen sind:
Nelken, Zimt, schwarzer Pfeffer, Muskantnuss, Kardamom, Weihrauch, Zucker, Galgant und Muskatnussblüte (Macis). Der Lange Pfeffer hat große Ähnlichkeit mit unseren heimischen Erlenpollen (zum Vergleich daneben liegend), stammt aber aus Indien.
Zur Herstellung von Tinte brauchte man Galläpfel. Diese entwickeln sich auf Eichenblättern, wenn die Eier der Gallwespe darauf abgelegt sind. In Verbindung mit Eisensulfat und Gummi arabicum wird Eisengallustinte hergestellt.
Aufbewahrt wurden Gewürze, Kräuter und sonstige Waren in bunt bemalten Büchsen.
Zu den Werkzeugen des Apothekers zählten unter anderem: Das „Ablassgeld“ wird meistens – aber nicht immer – für einen guten Zweck gespendet.
Mörser, Waage, Alembic (Destillationsapparat zur Herstellung wässriger Auszüge), Pfannen, Töpfe, Filter.
Die Ratsapothekerin des Hansevolks, Anna Lange, versorgt den Verein mit köstlichen Würzweinen und Konfekt. Das Publikum darf bei ihr Gewürze, Kräuter und Destillate schauen, schnuppern und fühlen.
Religion und Geistlichkeit: Ablass >
Ablassbrief, wie ihn die Kirchenoberen (Bischöfe, Erzbischöfe, Kardinäle oder der Papst selbst) herausgegeben haben. Darin stand, für welches gute Werk ein Ablass gewährt wurde und um wieviel Tage die Zeit im Fegefeuer verkürzt wurde.
Wer einen Ablass kaufte, bekam eine Ablassquittung auf seinen Namen ausgestellt.
Ablass:
Nach katholischem Glauben müssen die Seelen der Verstorbenen für eine bestimmte Zeit im Fegefeuer geläutert werden.
Es gibt aber Wege, diese zu verringern.
Zunächst müssen die begangenen Sünden bereut und gebeichtet werden. Der Beichtvater kann im Namen Jesu die Sünden zwar vergeben, jedoch nicht die Sündenstrafen aufheben. Dies geschieht in der persönlich zu leistenden Genugtuung. Bei einem Ablass wird die Strafe für Sünden aufgrund von guten Werken teilweise oder ganz erlassen. Gute Werke können sein: der Besuch bestimmter Messen, durch den Anblick oder die Berührung von Reliquien, durch Wallfahrten, Gebete oder durch Geldzahlung für bestimmte Zwecke.
Seit etwa 1450 traten immer mehr Mißstände zutage, da sich ein regelrechter Ablaßhandel entwickelte.
Hier setzte – unter anderem – die Kritik Martin Luthers und anderer Reformatoren an, die schließlich zur Spaltung der christlichen Kirche führte.
Beim Hansevolk gehört der „Ablasshandel“ zu den Programmpunkten bei Veranstaltungen. Das vom Publikum eingenommene „Ablassgeld“ wird für einen guten Zweck gespendet.
Religion und Geistlichkeit: Lübeck >
Im 15. Jahrhundert gab es innerhalb der Lübecker Stadtmauern fünf Pfarrgemeinden:
- Unser leven vruwen (St. Marien)
- Sünte petri ( St. Petri)
- Sünte jacobi (St. Jakobi)
- Sünte iljen (Ägidien)
- Sünte nicolai under dem domtorne (Domkirche St. Nicolai).
Der Dom St. Nicolai war zugleich Bischofssitz.
Im 15. Jahrhundert bestimmte tiefe Gläubigkeit den Alltag. Die allgegenwärtige Frömmigkeit fand vielerlei Ausdruck:
Ablasswesen – siehe Schaukasten Ablass.
Hochblüte der Marienfrömmigkeit
Heiligenverehrung, unter anderem Anrufung bei bestimmten Nöten
hohe Bedeutung der Sakramente:
Eucharistie, Taufe, Firmung, Ehe, Beichte,Krankensalbung, Priesterweihe,
Entstehung der besonderen Verehrung des Allerheiligsten in Prozessionen, Sakramentshäuschen, Monstranzen…
Reliquienkult: In den Reliquien waren die Heiligen in Form von Knochen oder Gewandstücken präsente Begleiter der Lebenden.
Wallfahrten – siehe Schaukasten Pilger
Hier findet Ihr mehr Informationen über das mittelalterliche Lübeck
Religion und Geistlichkeit: Mönch >
Drei Klöster gab es im 15. Jahrhundert in Lübeck:
- St. Johannis (Zisterzienserinnen)
- St. Katherinen (Franziskaner)
- St. Marien-Magdalenen (Dominikaner)
Der dargestellte Mönch gehört dem Orden der Dominikaner (predekers) an.
Der Orden wurde 1216 gegründet und etablierte sich schon 13 Jahre später auch in Lübeck, und zwar im Marien-Magdalenen-Kloster, auch als Burgkloster bekannt.
Die Dominikaner widmen sich der Theologie und Predigt. Sie legen Wert auf ein fundiertes Studium.
Im Hansevolk sprechen die Mönche Bruder Severin oder Bruder Johannes oder der Pfaffe Lawrenz, das Tischgebet. Auch beim „Ablasshandel“ zeigen sie ihre Überzeugungskraft als Prediger (siehe Schaukasten Ablass).
Religion und Geistlichkeit: Begine >
Von Flandern breitete sich seit dem 13. Jahrhundert eine Bewegung aus, wonach sich fromme Frauen zu kleinen religiösen Gemeinschaften zusammenschlossen.
Sie verpflichteten sich zu Keuschheit und Armut, waren aber – anders als Nonnen – nur an zeitliche Gelübde gebunden und konnten wieder austreten.
Man begegnete den Beginen mit Skepsis, denn sie entzogen sich der kirchlichen Disziplin und Lehraufsicht und lebten ohne eheherrliche oder väterliche Kontrolle. Teilweise wurden sie von der Kirche als Häretiker (Ketzer) verfolgt.
Den Beginen sagte man sowohl mystische Askese als auch einen recht lockeren Lebenswandel nach.
In Lübeck fanden die Beginen in der Bevölkerung eine positive Resonanz. Sie waren hier auf fünf verschiedene Konvente mit je 20 Frauen verteilt. Dort lebten sie von ihrer Hände Arbeit, wie Spinnen, Weben, Krankenpflege, Erziehung.
Die Begine im Hansevolk, Magdalena Dreyer, möchte mit historischen Werkzeugen das Handwerk einer Paternostermacherin (Herstellerin von Rosenkränzen) zeigen.
Schmiede >
Im spätmittelalterlichen Lübeck waren Schmiede um den Klingberg herum angesiedelt, besonders – wie der Name erkennen lässt – in der heutigen Schmiedestraße.
Neben den Bäckern, den Schustern und den Schneidern bildeten die Schmiede eines der größten Ämter (Innungen, Zünfte) der Stadt.
Es gab verschiedene Berufsfelder: Hufschmied, Grobschmied, Schlosser, Kleinschmied, Messerschmied, Waffenschmied, Nagelschmied, Pfannenschmied usw.
Schmiedeprodukte wurden von vielen anderen Handwerkern bezogen:
Dem Wagner lieferte der Schmied Reifen für die Räder und alles, was den Wagen fest zusammenhielt
Dem Schreiner fertigte er Beschläge für die Möbel.
Dem Bauhandwerker schärfte und härtete er das Werkzeug.
Vom Kunstschmied wurden auch gestalterische Fähigkeiten erwartet, z.B. bei Zierrat für Kirchen, Friedhöfe und Stadthäuser.
Ein Schmiedemeister durfte zwei Gesellen und einen Lehrling beschäftigen. Die Lehre dauerte 3 bis 5 Jahre, danach folgte eine genauso lange Wanderschaft. Um Meister zu werden, musste ein Meisterstück angefertigt werden.
Die ausgestellte Schmiede ist eine Mobile Feldschmiede:
Esse und Blasebalg werden in einem steckbaren Eichenrahmen zusammen gefügt. Der Doppelkammerblasebalg wird über die Handstange betätigt. Der Amboss steckt in einem Holzklotz, der vor Ort zusammengesteckt wird.
Ausgestellt sind Schmiedewerkzeuge ( Zangen, Hammer usw.) und allerlei Hausrat als tpyische Produkte eines Kleinschmieds.
Der Schmied des Hansevolks, Georg Iserenhant, liefert der Küche Töpfe, Pfannen, Kellen und Messer und fertigt Zelthaken, Kerzenhalter und allerlei Gerät. Für das Publikum ist die Schmiede immer eine besondere Attraktion, denn vom Feuer war der Mensch schon immer fasziniert.
Schreiberei, Schriverie >
Im 15. Jh. konnte nur etwa jeder Zehnte schreiben und lesen. Alle anderen waren auf Hilfe angewiesen, zum Beispiel durch einen professionellen Schreiber.
Ein Schreiber musste verschiedene Schriften beherrschen, mindestens drei: Textur, Bastarda, Kurrent. Aus der Kurrent hat sich allmählich die Deutsche Schreibschrift entwickelt.
Die Sprache ist mittelniederdeutsch, Vorläufer des Platt. Eine offizielle Rechtschreibung gibt es noch nicht, allenfalls individuelle Schreibgepflogenheiten. Gelegentlich wird auch lateinisch geschrieben.
Die Utensilien des Schreibers: Gänsefederkiel (gosepose), Federmesser (vedder- mest), Büttenpapier (pap- pir), Pergament (perment), Tintenhorn (inkethorn) mit Tinte, Lineal, Stift zum Linienziehen z. B. aus Silber (sülverstift).
Für den ambulanten Dienst gab es das Pennal (lat. Penna = Feder), ein kleines Tintenfass mit Federköcher, das am Gürtel getragen wurde.
Für den Alltag und in der Schule gebrauchte man einen Wachstafelkodex und Griffel.
Papier gab es bei uns seit dem im 14. Jahrhundert. Es gab in Lübeck eine Papiermühle.
Urkunden mussten auf Pergament geschrieben werden. Pergament wird aus der Haut von Kälbern, Schafen oder Ziegen gemacht („Das geht auf keine Kuhhaut“).
Der Schreiber des Hansevolks, Johann Otteshude, kopiert alte Schriften, setzt aber auch „Urkunden“ auf, wie z.B. den Ablassbrief und die Ablassquittungen (siehe Religion und Geistlichkeit) oder schreibt Einladungen und Glückwunschkarten.
Spielmann >
Spielleute traten bei Festen und anderen gesellschaftlichen Begebenheiten auf.
Zum fahrenden Volk gehörig, eilte ihnen ein zwielichtiger Ruf voraus. Sie waren „unbehaust“, d.h. nicht sesshaft und damit keine Bürger! Sie konnten und mussten von Ort zu Ort reisen.
Im späten Mittelalter gab es auch die ersten sesshaften Spielleute, die sich Stadtpfeifer nennen durften. Lübeck hatte 1474 zwölf davon. Sie bildeten ein eigenes Amt (Zunft).
Bezahlt wurden die Musikanten manchmal mit Geld, oft in Naturalien oder Gewandstücken.
Spielleute beherrschten meist mehrere Instrumente. Hier wird nur eine kleine Auswahl gezeigt:
• Schlüsselfidel, Nachbau eines Fundes von 1526 in Schweden („Moraharpa“).
1 Spielsaite, 2 Bordunsaiten, die immer mit gleichem Ton klingen.
Der Schlappbogen ermöglicht eine sehr rhythmische Spielweise, z.B. bei der Tanzmusik.
• Hümmelchen: Kleiner, relativ leiser Dudelsack. Neben der Spielpfeife hat das
Instrument einen sog. Bordun: eine Pfeife mit einem durchgehenden Ton (daher auch „Dudelsack“).
• Knochenflöte, gefertigt aus einem Schafsknochen, mit geringem Tonumfang. diese Art von Flöten ist seit vielen Jahrhunderten überliefert.
Der Spielmann, Notzelmann van Molne, geht dem Hansevolk bei Umzügen voran. Vor allem aber spielt er zum Tanze auf.
Stadttrommler >
Als Repräsentant Lübecks trägt der Trommler Tappert und Turban in den Farben der Stadt.
Zu hören ist der Stadttrommler bei allen offiziellen Festen, Aufzügen und Verlautbarungen der Stadt bzw. des Rates.
Darüber hinaus begleitet er die Kriegsknechte bei militärischen Aktionen, wie z.B. das Lübecker Kontingent zum Entsatz nach Neuss 1475.
Da der Rat immer bestrebt ist, bare Geldzahlungen so weit wie möglich durch Privilegien zu ersetzen, hat der Trommler die Erlaubnis, zusammen mit anderen Spielleuten bei allen privaten Festen gegen Entlohnung zum Tanz aufzuspielen.
Ausgestattet mit Feldflasche und Umhängetasche, ist der Trommler praktisch abmarschbereit.
Im Lager des Hansevolks kündigt der Trommler, Bertold Speksnider, Mahlzeiten und andere wichtige Ereignisse an. Bei Festumzügen geht er, neben dem Spielmann und dem Bannerträger, mit der Trommel voran. Am Abend spielen Trommler und Spielmann dem Hansevolk und dem Publikum zum Tanze auf.
In den Feldschlachten der spätmittelalerlichen Reenactment-Szene (z.B. Antwerpen, Pavia, Soest) zieht der Trommler tapfer mit ins Feld.
Marstall (Stadtwächter) >
Das ganze Mittelalter hindurch bestand für die Lübecker Bürger Wach- und Wehrpflicht. doch schon früh hat es in Lübeck zur Bewachung der Tore und Mauern zusätzliche, professionelle Wächter geben, da dieser Dienst von den berufstätigen Bürgern allein nicht zu leisten war.
Diese Wächter waren Unergebene der beiden Marstallherren (Ratsherren), deren Zuständigkeit es ursprünglich war, für den Rat Pferde und Reiter bereitzustellen. Daher auch die Bezeichnung Marstall, was lediglich „Pferdestall“ bedeutet.
Die Marstallherren und ihre Bediensteten waren aber nicht nur für den Schutz der Stadtmauern und -tore verantwortlich, sondern auch für alle Belange von Sicherheit, Ordnung und Verteidigung der Landwehr, d.h. des Stadtgebiets außerhalb der Stadtmauern. In Kriegszeiten wurden zusätzliche Söldner angeworben.
Der hier ausgestellte Wächter trägt eine Ausrüstung, wie sie in Kriegszeiten zum Einsatz kam. In ruhigen Zeiten wird er seinen Dienst sicherlich leichter gerüstet versehen haben.
Er trägt einen Eisenhut, einen Bart (Kinn- und Halsschutz), Brust- und Schulterpanzer sowie gepanzerte Handschuhe. Unter dem Brustpanzer sorgt ein Gambeson – eine Art gesteppter Jacke – für ausreichende Polsterung und für Schutz der nicht durch Blech bedeckten Körperstellen.
Seine Hauptwaffe ist die Hellebarde. Zusätzlich trägt er noch ein „langes Messer“ (einschneidiges Kurzschwert) und einen Scheibendolch. Die übrige Kleidung entspricht der zivilen Mode. Eine Uniformierung von Kopf bis Fuß gibt es noch nicht.
Totentanz >
Der Gedanke an die Vergänglichkeit des Erdendaseins war dem mittelalterlichen Menschen viel näher als uns heute.
In Bildern, Liedern und in Mysterienspielen wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass der Tod letztendlich jeden von uns holen wird, hoch oder niedrig von Stand, arm oder reich, alt oder jung.
Ein beliebtes Motiv war der Totentanz: Der Tod, dargestellt als modernder Leichnam, zieht die Menschen unausweichlich in seinen makabren Reigen.
Der Maler Bernt Notke hat 1463 die Lübecker Marienkirche mit einem Totentanz ausgemalt. Die Texte der einzelnen Figuren, damals in mittelniederdeutscher Sprache, sind nur noch als Fragment erhalten. 1701 wurden die Bilder von Anton Wortmann restauriert, und auch die Texte wurden nachgedichtet (Nathanael Schlott).
Die gezeigten Figuren sind der Tod, der Kardinal und, die Bäuerin (im Original: der Bauer).
Das Hansevolk hat Bild und Text des Lübecker Totentanzes in lebendige Szenen umgesetzt. Das Stück wurde 2008 in Lübeck und 2009 in Wismar aufgeführt.
Text nach Nathanael Schlott, 1701
Der Tod an den Kardinal:
Gib gute Nacht der Welt, bestürzter Kardinal;
Dein Ende rufet dich zur ungezählten Zahl.
Ich weiß nicht, was du dort wirst für ein Teil erlangen,
Das weiß ich, Sohn, du hast viel Gutes hier empfangen.
Der Kardinal:
Rom schenkte mir den Hut, der Hut trug Ehr und Geld.
So baut’ ich sorgenfrei das Paradies der Welt.
Mein Wunsch war, mit der Zeit auf Petri Stuhl zu rücken.
Und muss davor erblasst das Haupt zur Erde bücken.
Der Tod an die Bäuerin:
Komm, Landfrau, an den Tanz, von Müh und Arbeit heiß,
so schwitztest du zuletzt den kalten Todesschweiß.
Lass andre sein bemüht mit pflügen, dreschen, graben:
Dein saurer Lebenstag soll Feierabend haben.
Die Bäuerin:
Ich trug mit Ungemach des Tages Last und Not,
und aß, von Schweiß bedeckt, mein schwer verdientes Brot;
doch da mein Führer mich zur Ruhe denkt zu bringen,
so kann ich wohlvergnügt das Consummatum singen.